Wie vital sind die Hochstämme?
- Veröffentlicht am

Der Klimawandel stellt die etwa 7 Mio. Bäume auf baden-württembergischen Streuobstwiesen vor neue Herausforderungen. Aus den letzten Jahren gut in Erinnerung geblieben sind die langanhaltenden und häufigen Trockenphasen während der Vegetationsperiode. „Im Durchschnittlich verlängern sich die Trockenperioden jedes Jahr um zwei Wochen. In vielen Jahren haben die Böden ein Wasserdefizit“, sagt Fleckenstein. Die Niederschläge verschieben sich dagegen immer mehr in die Wintermonate. Die Temperaturen steigen schon früh im Jahr, sodass die Obstblüte häufig schon beginnt, wenn die Frostgefahr noch hoch ist. Zu den Profiteuren des Klimawandels zählen dagegen unter anderem der Schwarze Rindenbrand (Diplodia sp.) und die Laubholzmistel (Viscum album subsp. album), welche zunehmend zum Problem im Obstbau werden. „Es gibt Gebiete, wo es keinen einzigen Baum ohne schwarzen Rindenbrand gibt“, berichtet Fleckenstein von seinen Baumaufnahmen.
Vitale Streuobstwiesen trotz Klimawandel
Um die Streuobstwiesen der Zukunft auf weitere klimatische Veränderungen vorzubereiten, ist es wichtig, die lokalen Auswirkungen des großräumigen Klimawandels zu kennen. Hier setzt das Projekt „Streuobstwiesen im Klimawandel“ an, das noch bis 2024 läuft. Kevin Fleckenstein von der Universität Hohenheim stellte erste Ergebnisse des Projekts vor. Ziel seiner Arbeit ist es, mittels Geodatenanalysen herauszufinden, wie die untersuchten Faktoren – vom Klima über den Boden bis hin zur Sorte – die Vitalität der Bäume beeinflussen.
Hierzu erfassen die Forschenden den Zustand von Einzelbaumbeständen in Baden-Württemberg und verschneiden die Information mit historischen Klimadaten, Luftbildern, Bodenkarten, Geländemodellen und den Daten von Klimasensoren am Baum. So kleinräumig wurden lokale Klimadaten im Zusammenhang mit dem Zustand der Streuobstbäume noch nicht aufgenommen.
„Der Klimawandel ist schon da. Machen Sie sich also Gedanken, was Sie in Zukunft beachten müssen.“
Kevin Fleckenstein
Die Universitäten Tübingen und Hohenheim arbeiten hierfür mit den Umweltberatern des AT-Verbands in Stuttgart zusammen. Fleckenstein steht zudem im Austausch mit Pomologen wie Hans Thomas Bosch, Thilo Tschersich, Markus Zehnder, Walter Hartmann und Hartmut Maier. Die letzten beiden haben im Raum Filderstadt bereits etwa 25.000 Obstbäume kartiert – ein Schatz für die Forschung.
Die Wissenschaftler wiesen bereits nach, dass die Schnittpflege etwa zur Hälfte die Vitalität des Baums bedingt. Nur etwa 50% der untersuchten Bäume hatten kein Totholz und nur etwa 34% der Bäume werden regelmäßig gepflegt. Die Totholzanteile waren in der Tendenz an Süd- und Westhängen höher als auf Ost- und Nordhängen oder ebenen Flächen. Die Ursachen hierfür werden noch untersucht. Erstaunlich seien auch die großen klimatischen Unterschiede der Untersuchungsgebiete gewesen, wonach das Kleinklima selbst innerhalb einer Anlage deutlich variiert.
Die Hoffnung ist, aus den Ergebnissen Sorten- und Standortempfehlungen für zukünftige Obstwiesen ableiten zu können, damit diese wertvolle Kulturlandschaft auch im Klimawandel weiter bestehen kann. Ein Hindernis hierfür sei, dass die Sorten eines Streuobstbestandes oft unbekannt sind.
Sorten mit Genanalysen bestimmen
Bei diesem Problem könnte die Sortenbestimmung anhand genetischer Fingerprints helfen, deren Möglichkeiten Pomologe Hans-Joachim Bannier vorstellte. Bei dieser Methode werden Genproben einer mutmaßlichen Sorte genommen, um sie mit anderen Genproben derselben Sorte abzugleichen. Etwa 1440 Apfelsorten der Deutschen Genbank Obst sind in der Datenbank von Ecogenics für einen solchen Abgleich hinterlegt. So lässt sich mehr Sicherheit bei der Sortenbestimmung erhalten – zum Beispiel, wenn Früchte für eine pomologische Bestimmung fehlen. Die Methode ermittelt allerdings keine Sortennamen, sondern lediglich, ob zwei Bäume genetisch identisch sind.
„Eine pomologische Sortenbestimmung bleibt weiterhin ratsam“, sagt Bannier. Denn die Methode bringt Unsicherheiten mit sich. Zum einen sind in der Gendatenbank die Sortennamen hinterlegt, unter denen sie von den Pomologen genannt wurden. Hier können sich Fehler einschleichen – insbesondere bei pomologisch schwer unterscheidbaren Sorten. So ergaben Untersuchungen, dass etwa ein Viertel der Bäume der Deutschen Genbank Obst (DGO) sortentechnisch falsch eingruppiert war. Auch beim Sammeln des Genmaterials können Fehler auftreten, beispielsweise bei durchgewachsenen Unterlagen oder wenn die Proben im Labor verwechselt werden.
Neben der Deutschen Datenbank von Ecogenics gibt es auch eine Europäische Fingerprint Datenbank. Diese enthalte ebenfalls noch viele Fehler, so Bannier. Was sie allerdings offenbart ist, dass viele Sorten europaweit verbreitet sind – allerdings oft mit unterschiedlichen Namen.
Schnitteingriffe in Ertrags- und Altbäume
Obstbaumeister Kai Bergengruen sprach ein viel diskutiertes Thema an: Den Schnitt großkroniger Obstbäume. „Wie stark und vor allem wie ich in einen großkronigen Obstbaum eingreifen sollte, lässt sich nur in Abhängigkeit einer gründlichen Baumansprache und einer klaren Zielsetzung beantworten“, ist Bergengruen überzeugt. Er plädiert dafür, sich von Konzepten wie dem Oeschbergschnitt zu lösen und die Schnittintensität stattdessen an die geplante Nutzung und den Vitalitätszustand eines Baums anzupassen – mit dem Ziel, Reservestoffe des Baums zu schonen und damit dessen Lebensdauer sowie die notwendigen Eingriffsintervalle zu verlängern.
Der in den 1920er Jahren von Hans Spreng entwickelte Oeschbergschnitt zielte vor allem auf die Erzeugung von hochwertigem Tafelobst ab: Der strukturierte Hochstamm ist gut beerntbar, gut pflegbar, pflanzenschutzfähig und stabil. Die ordentliche, hierarchische Kronenform wird dabei unabhängig vom natürlichen Wuchscharakter herbeigeführt. „Je intensiver die Nutzung, desto intensiver der Schnitt“, erklärt Bergengruen. Heute sei die Tafelobsterzeugung allerdings nicht mehr so gefragt.
Stattdessen gehe es inzwischen eher darum, Streuobstwiesen als Lebensraum und identitätsstiftendes Landschaftselement zu erhalten. Denn ein Großteil der Altbäume befindet sich in einem schlechten Zustand. Das Obst wird, wenn überhaupt, eher extensiv genutzt. Für den Schnitt alter Hochstämme sei deshalb das baumindividuelle Vorgehen eine Option. Dabei wird die Schnittintensität an den Vitalitätszustand eines Baumes und die geplante Nutzung angepasst. So ließe sich nicht nur die Lebensdauer des Baumes verlängern, sondern auch die Eingriffsintervalle.
Ein Teilnehmer der Frühjahrstagung berichtet aus Thüringen, dass Oeschbergkronen in den vergangenen heißen und trockenen Jahren häufiger abstarben, vermutlich infolge von Sonnenbrand. „Wir tun dem Baum in der derzeitigen Situation keinen Gefallen mit dem Oeschbergschnitt!“, so der Teilnehmer. Dafür zeichneten sich alte Oeschbergkronen durch große Stabilität aus, hält Bergengruen dagegen. Dennoch: Für geschwächte Bäume sei es wichtig, ihre Reservestoffe zu schonen. „Je triebschwächer der Baum, desto schwächer die Schnitteingriffe“, sagt Bergengruen. Die Reservestoffe lagern vorwiegend im Splintholz besonders steil stehenden und schnellwüchsigen, jungen Holzes. Entfernt man solche jungen Zweige anstelle eines alten unterständigen Astes, nimmt man dem Baum damit mehr Reservestoffe. Meistens sei weniger mehr, so Bergengruen.
Standards in der Obstbaumpflege
Ingmar Kruckelmann, Sprecher der AG Obstgehölzpflege, stellte passend dazu das neue Beurteilungsblatt des Pomologen-Vereins zur Regenerationsfähigkeit von Obstbäumen vor, das bis Sommer 2023 zur Verfügung stehen soll. (Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Pomologen-Vereins). Die Qualitätsstandards sollen bei der Einschätzung helfen, ob Bäume noch vital genug sind, um auf einen Schnitt zu reagieren, und sind damit zentraler Bestandteil der Baumansprache.
Die Regenerationsfähigkeit richtig zu beurteilen ist entscheidend für die Herleitung des Pflegeziels und eine zweckmäßige Obstbaumpflege. „Nicht alle Bäume sind noch in der Lage, auf Eingriffe zu reagieren auch bei starkem Schnitt“, erklärt Kruckelmann. Neben dem jährlichen Triebzuwachs werden auch weitere Merkmale zur Einschätzung der Regenerationsfähigkeit betrachtet. Dazu zählen:
- Belaubungsdichte, Laubfarbe und -größe
- Astdichte im Kronenquerschnitt (eher dicht oder schütter?)
- Totholz: Lage in der Krone und Anteil am Kronenvolumen
- Schadorganismen (Mistel, Baumpilze)
- Wundheilung: Kallusbildung
- Kronenstruktur, Verzweigungsmuster
Für einen vitalen Altbaum spricht beispielsweise, wenn der Hauptteil der Blattmasse an längeren Kurztrieben (5-20cm lang) gebildet wird.



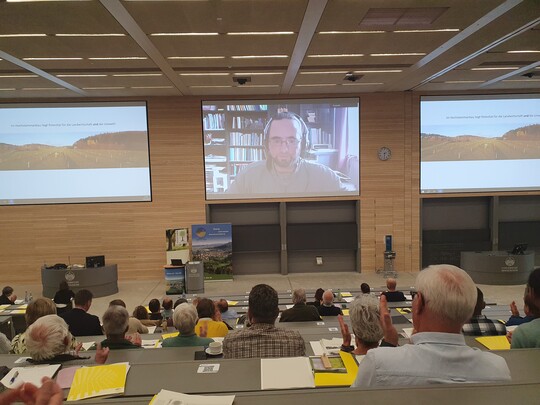







Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.